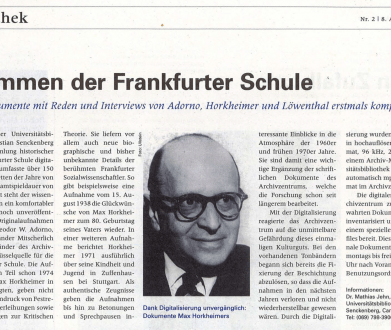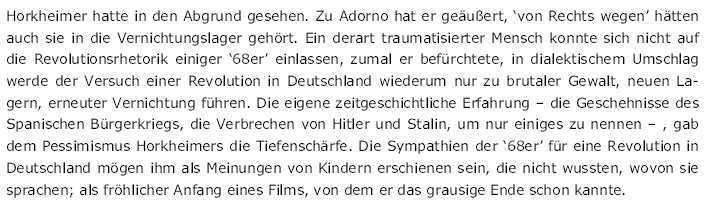Er ist gegen die Idee einer Revolution und für Theorie ohne Praxis, 1951 und 1952 ist er Rektor der Universität, Direktor des Instituts für Sozialforschung.
Max Horkheimer kritisiert durchgehend die Krakeeler und Rebellen, deren Aktionen auf die Vergewaltigung der großen Mehrheit der Studenten und selbst der reformwilligen Dozenten hinauslaufe.
„Was es heute zu verteidigen gilt, scheint mir ganz und gar nicht die Aufhebung der Philosophie in Revolution, sondern der Rest der bürgerlichen Civilisation zu sein, in der der Gedanke individueller Freiheit und der richtigen Gesellschaft noch eine Stätte hat.”
Horkheimer: Brief an Adorno v. 27. September 1958
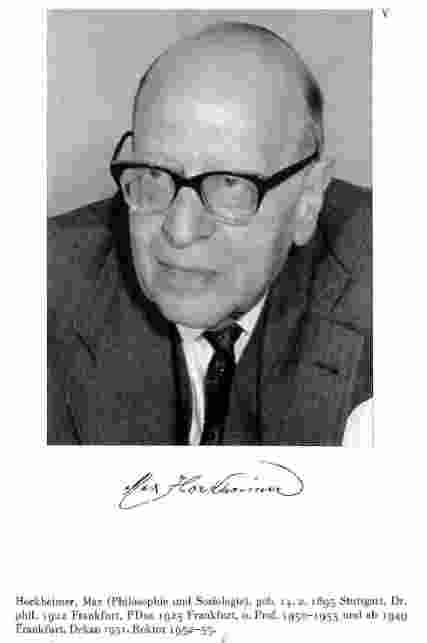

Die Angst vor dem grausigen Ende
Norbert Rath, Horkheimers und Adornos Stellung zur Protestbewegung von 1968, in Kritiknetz – Zeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft, 2018:
„Eine Revolution führt in die Diktatur“
„In der Tat stand ich immer kritisch zu einer ganzen Reihe von Momenten in der Gesellschaft, in der wir leben. Weil ich darüber geschrieben habe, können sich die Studenten auf mich berufen. Was mich von der Studentenbewegung unterscheidet ist meine Überzeugung, dass heute eine Revolution im Westen die Gesellschaft nicht verbessern, sondern, indem sie zur Diktatur führen müsste, wesentlich verschlimmern würde.“
Max Horkheimer, Gespräch mit Monika von Zitzewitz, zitiert nach: Alex Demirovic, Bodenlose Politik – Dialoge über Theorie und Praxis, in: Wolfgang Kraushaar, Frankfurter Schule und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum Molotowcocktail, Hamburg, 1998, Seite 72.
Gegen eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft
„Der Protest der Studenten geht weit über die ursprüngliche Forderung nach Universitätsreform hinaus und zentriert sich mehr und mehr auf eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft…―“
Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt am Main, 1988, 504
Max Horkheimer: „Die Affinität zur Geisteshaltung der nach der Macht strebenden Nazis ist unverkennbar.“
„Aus der durchaus berechtigten Forderung nach der längst fälligen Reform der Universität machen sie Ansprüche auf ihre Rechte, die auf die Vergewaltigung der großen Mehrheit der Studenten und selbst der reformwilligen Dozenten hinauslaufen, und diese Ansprüche machen sie mit Methoden geltend, die man nur als diejenigen eines linken Faschismus verstehen kann. Die Affinität zur Geisteshaltung der nach der Macht strebenden Nazis ist unverkennbar.“
Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt am Main, 1988, Seite 512
Max Horkheimer und sein Unverständnis, was die „Rebellen“ wollen
„Aber all diese Überlegungen (…) helfen wenig zu verstehen, was in den intelligentesten und der aufrührerischen Rebellen (…) eigentlich vorgeht.“
Albrecht Wellmer, Die Bedeutung der Frankfurter Schule heute, in: in: Axel Honneth und Albrecht Wellmer (Hg.), Die Frankfurter Schule und die Folgen, Berlin, 1986, 505
„Dass sich Habermas in der Antiatom- bzw. Friedensbewegung engagierte und gegen die amerikanische »Politik der Stärke« vernünftige Gründe vortrug, brachte Max Horkheimer in Rage. In den Protestmärschen und Demonstrationen sah er nur »verärmlichte, verflachte und vulgarisierte« Kopien der Französischen Revolution. Habermas’ Literaturbericht »Zur philosophischen Diskussion um Marx und den Marxismus« in der angesehenen Philosophischen Rundschau brachte das Fass zum Überlaufen. Horkheimer schrieb im September 1958, auf dem Höhepunkt der Proteste der Friedensbewegung, den längsten Brief seines Lebens – neun Druckseiten – an Adorno. Horkheimer legte Adorno nahe, den »studentischen Propagandisten« Habermas, der mit seiner Marxinterpretation »nur den Geschäften der Herren im Osten Vorschub« leiste, möglichst schnell und lautlos aus dem Institut zu entfernen, da er diesem nur Schaden zufügen könne. Die Öffentlichkeit erfuhr von diesem Brief erst 1973 – vier Jahre nach Adornos Tod. Horkheimer revidierte sein krasses Fehlurteil über Habermas von 1958 bereits 1960 und empfahl den 30-Jährigen dem »American Jewish Committee« als »meistversprechenden Intellektuellen der Bundesrepublik«.“
Rudolf Walther, Studentenbewegung und »Frankfurter Schule«, Politische und mentale Barrieren, in: Frankfurter Hefte, 1. Juni 2018, Ausgabe 6, 2018
„Zehn Tage nach der Ermordung Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967 diskutierten Adorno und Horkheimer in einem Frankfurter Studentenheim mit dem SDS über Horkheimers Rede. Adorno vertrat zwar einen »emphatischen Praxisbegriff«, verglich aber Demonstrationen ungeniert mit den »Bewegungen eingesperrter Tiere«. Auf die aktuelle Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis angesichts des von einem Polizisten erschossenen Studenten, bekamen die Studenten von den beiden Vertretern der »Kritischen Theorie« keine Antwort. Hans-Jürgen Krahl vom Frankfurter SDS raunte von »anderen Mitteln als jene der klassischen Aufklärung«.“
Rudolf Walther, Studentenbewegung und »Frankfurter Schule«, Politische und mentale Barrieren, in: Frankfurter Hefte, 1. Juni 2018, Ausgabe 6, 2018
An Stelle des Proletariats trat die Theorie als „Statthalterin der Befreiung― und mit dieser die „theoretisierende Avantgarde“ als historisches Subjekt. Diese beschränkte sich, wie Horkheimer in „Traditionelle und Kritische Theorie“ – festhielt, allerdings auf einen kleinen Kreis: Das offenbart wiederum den elitären Charakter der Kritischen Theorie: Sie will so das Bürgertum in Form seiner Intelligenz wieder in die unverdiente Avantgarderolle versetzen. Signifikant scheint, dass den Intellektuellen laut Horkheimer auch gleich die bescheidene Aufgabe zufiel, „die Spannung zwischen ihrer Einsicht und der unterdrückten Menschheit, für die sie denken zu verringern. Nicht die Menschen selbst sollten also denken, sondern eine kleine Elite auserwählter Bildungsbürger erledigt das „für den als dumpf betrachteten Plebs. Das heißt: Anstatt mit den Menschen, vormundschaftlich für sie zu agieren. Ein ganz ähnlicher Gedanke findet sich übrigens bei Herbert Marcuse: Er meint, auf Grund der Angepasstheit müsse man schließen, „dass Befreiung Umsturz gegen den Willen der großen Mehrheit des Volkes bedeutet.“ Genau diese Haltung entspricht aber einer grundlegenden Voraussetzung bürgerlicher Herrschaft: Bevormundung und Ausschluss der Massen! Bei den Studenten förderten solche Überlegungen natürlich das avantgardistische, wenn nicht elitäre Verständnis der eigenen Rolle. So gesehen kann man die „Frankfurter Schule“ nicht von einem Verschulden freisprechen, ideologisch zu einer verhängnisvollen Isolierung der Studentenrevolte beigetragen zu haben.
Max Horkheimer und Herbert Marcuse
„H[ erbert] M[arcuse] ist der Prototyp der radikalen Intellektuellen, die nicht etwa nur die Mißstände im eigenen Land angreifen, sondern gleichzeitig mit dem Osten sympathisieren. Damit propagieren sie aber die schlimmste Art der Barbarei. Heute kommt es aber allein darauf an, zu retten, was von der persönlichen Freiheit noch übrig ist. Radikal sein heißt heute konservativ sein. Denn der Trend zeigt eindeutig auf den Übergang der Macht von der Legislative auf die Exekutive, das heißt aber eine Entwicklung zur totalen Bürokratie. Die Zuchthaussysteme des Ostens sind viel schlimmer als die teilweise grobe Verfälschung der demokratischen Ordnung im Westen.“
Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt am Main, 1988, Seite 413
Max Horkheimer: Die Studenten machen Krakeel (November 1967)
„Die Universität gibt ihnen Steine statt Brot, soweit es sich nicht um reine Fachausbildung handelt (aber auch diese wird immer problematischer, unadäquater). Mit normalen Versammlungen, gesitteten Demonstrationen haben sie nichts erreichen können. Die Universität nahm keine Notiz davon, man war sozusagen unter sich. Jetzt machen sie Krakeel, so daß man sie nicht mehr überhören kann. Das »Go-in« in die Vorlesung von Carlo.Schmid hatte seinen guten Sinn. Wen interessiert von einem führenden Politiker statt einer Stellungnahme zu den brennenden Tagesproblemen eine Vorlesung zu hören über, >Theorie und Praxis der Außenpolitik am Beispiel der Gruppierung der Großmächte im achtzehnten Jahrhundert<. Die Wahl des Themas ist typisch dafür, wie die politische Wissenschaft wieder in harmlosen Geschichtsunterricht entpolitisiert wird. Als ob man über ein Thema, über das man sich in unzähligen Büchern informieren kann, einen Mann zu hören brauchte, der Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten war und aktiver Minister ist. Ist die Forderung, er solle über die Notstandsgesetzgebung mit den Stu denten diskutieren, nicht berechtigt?“
Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt am Main, 1988, Seite 453
Max Horkheimer: Die Revolte
Eine Untersuchung über die Psychologie der rebellierenden Studenten (September 1968)
„Über ihre eigentlichen Motive haben wir nichts als Vermutungen oder ihre eigenen Aussagen, die offenbar an der Oberfläche bleiben. Sie sind gegen das »Establishment«, gegen »Repression«, auch wenn sie im Gewande der Toleranz auftritt, gegen die Hypokrisie, die sich in allen öffentlichen und privaten Beziehungen zeigt, und für die Verwirklichung der alten bürgerlichen Ideale. Sie wissen, daß diese Ideale in den sogenannten sozialistischen Ländern ebenso zu Werkzeugen der Manipulation mißbraucht werden wie Christentum und Liberalismus im Westen. Auch das Malaise über die Zukunft in einer atombedrohten Welt, die Empörung über Vietnam und Biafra, aber auch recht handfeste Motive wie die Mißstände an den Universitäten oder, daß die Hälfte der deutschen Soziologiestudenten und der 600000 französischen Studenten keinen ihrer Ausbildung adäquaten Job finden können, spielen eine Rolle. Wenn man etwas tiefer geht, dann stößt man auf bekannte psychologische Befunde: die Opposition des Sohnes gegen die doppelte Moral des Vaters, dem er den Abgrund zwischen seiner Weltanschauung und seiner Praxis entgegenhält, den Verlust der Autorität des Vaters und die Entfremdung von der sich auflösenden Familie, den Mangel an einem moralischen Halt, den früher einmal die Religion oder eine politische Partei oder Patriotismus und Nationalismus gewährt haben. Dazu kommt ferner, daß die Sublimierung der Aggression weniger und weniger eingeübt wird. [Dies steht im] Zusammenhang mit der Enttabuisierung der sexuellen Beziehun gen, und daher [rühren], selbst bei den Intellektuellen (bei den Kleinbürgern war es schon lange so), die heftigsten Aggressionen, die mühsam unterdrückte Wut [, die] dicht unter der Oberfläche sich aufhalten. Sobald eine Situation eintritt, in der die brüchigen Hemmungen durchstoßen werden können, erfolgt der Ausbruch. Wenn dem so ist, dann ist der Anlaß relativ gleichgültig. Es gibt genug Zeichen dafür, daß die studentische Rebellion auch in den Dienst des Rechtsradikalismus treten kann.“
Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 14, Späne. Notizen über Gespräche mit Max Horkheimer, Frankfurt am Main, 1988, Seite 501
Max Horkheimer: Die Motive der rebellierenden Studenten (Dezember 1968)
„Die soziologischen und psychologischen Wurzeln der Rebellion unter den Studenten der westlichen Welt sind im großen und ganzen bekannt. Darüber gibt es schon eine große Literatur. Aber darüber, was die Studenten im Grunde bewegt, gibt es unseres Wissens keine zureichende Untersuchung. Es liegt auf der Hand, daß es sich um eine Krise der Autorität auf allen Lebensgebieten handelt. Familie und Religion sind im Zerfall. Mit der Autorität des Vaters ist auch diejenige der Vaterperson, also der Spitzen der Regierung [und] insbesondere diejenige der Professoren im Schwinden. Ursächlich und zeitlich hängen diese Vorgänge zusammen mit dem elenden Zustand der Welt, dem Abgrund zwischen den offiziell gültigen·Anschauungen und der Wirklichkeit, [der] Bedrohung vom Osten und [dem] Wissen über die Gefahr der totalen Vernichtung durch einen atomaren Krieg. Dazu kommt die Unfähigkeit der Universitäten, sowohl die humanistischen Bildungsideale wie eine adäquate Ausbildung zu vermitteln. Dieser unleidliche Zustand wird verschärft durch Formen der Verwaltung und des Lehrplans ebenso wie die chaotische, mit offen kundigem Ballast überfüllte Gestaltung des Programms sowie als sinnlos empfundene Prüfungsanforderungen. Der Protest der Studenten geht aber weit über die ursprüngliche Forderung nach Universitätsreform hinaus und zentriert sich mehr und mehr auf eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft. Ohne daß durchdachte Forderungen vorlägen, wie die neue Gesellschaft aussehen und mit welchen Mitteln sie herbeigeführt werden soll. Die Erklärung, daß die Rebellion von einem sich neuerdings bildenden akademischen Proletariat getragen wird, reicht nicht aus. Es steht fest, daß viele der radikalsten Studenten ebenso wie eine Mehr zahl der Hippies aus »gutbürgerlichen« Familien stammen, für deren Zukunft gesorgt ist. Offenbar gehört zu den psychologischen Wurzeln des Aufruhrs die in jeder Generation des bürgerlichen Zeitalters – wenn auch nicht in diesem Umfang – beobachtete Rebellion gegen den Vater. Die Ideale, welche dieser in der Erziehung vermittelt und die in so offenkundigem Gegensatz zu seiner Lebenspraxis stehen, werden hypostasiert und gegen ihn gehalten. Das alte Pubertätsphänomen in radikalerer Form. Aber es genügt nicht zur Erklärung der Vorgänge. Hinter dem Haß und der Gewalttätigkeit steckt offenbar auch die Sehnsucht nach dem sinnvollen Leben. Die alten bürgerlichen Ideale, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, treten, wenn auch in verzerrter Form, hervor: Die Freiheit im Sinn der Auflehnung gegen jede Repression ohne das Wissen, daß kene Gesellschaft, die überleben will, uneingeschränkte Freiheit gewähren kann, und daß obendrein die Forderung nach Freiheit mit der nach Gerechtigkeit nicht zu vereinen ist. Die Forderung nach Gleichheit geht ebenso weit über das hinaus, was in einer auf Arbeitsteilung gegründeten Gesellschaft verwirklicht werden kann. Das Mitspracherecht an der Universität nimmt im Munde der Studenten heute unsinnige Gestalt an. Obendrein werden Freiheit und Gleichheit für alle, die anderer Meinung sind, auf totalste Weise niedergebrüllt. Die Forderung nach Brüderlichkeit tritt in Formen auf, die aufs peinlichste an die »Volksgemeinschaft« erinnern. An den Wunsch nach Geborgensein in einer mächtigen Gruppe, das aus der in der heutigen Gesellschaft vorherrschenden Isoliertheit heraus hilft. Es ist nicht schwer vorauszusagen, daß die heutigen Rebellen, oder mindestens viele von ihnen, sich in eine neue totalitäre Ordnung begeistert einfügen würden. Aber alle diese Überlegungen, mögen sie im Kern noch so richtig sein, helfen wenig zu verstehen, was in den intelligentesten der aufrührerischen Rebellen, die alles Obengesagte wissen müßten, eigentlich vorgeht.
Nachtrag: Die rebellische Haltung, vor einem Jahrzehnt noch das Privileg von Einzelgängern, ist heute Ausdruck des Konformismus. Man will dazugehören, nicht als Schlappschwanz gelten. Diese Motivation und nicht etwa eine echte Auflehnung gegen die Gesellschaft motivieren die langen Haare und Bärte, die saloppe Kleidung, die Verhöhnung der Tabus und die Beteiligung an Demonstrationen und Gewalttätigkeiten.“
Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 14, Späne. Notizen über Gespräche mit Max Horkheimer, Frankfurt am Main, 1988, Seite 505
Das Archivzentrum der Universitätsbibliothek mit Reden und Interviews von Max Horkheimer und Adorno